2.3.4. Mentalität und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft 2.4. Verhandlungen Thatcher - Deng Xiao Ping 2.4.1. Machtverhältnisse zum Zeitpunkt der Verhandlungen 2.4.2. Inhalte der Vereinbarungen 2.5. Staatsaufbau (Stand September 1991)
![]() 2.3.4. Mentalität
und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft
2.3.4. Mentalität
und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft
Wirtschaftlicher Erfolg aber auch zu erwartende Zukunftsprobleme
Hong Kongs sind nicht zuletzt in der Mentalität seiner
Einwohner begründet. Sie wurde durch den britischen
Kolonialstil, die chinesische Kulturtradition und die politischen
Ereignisse des 20. Jahrhunderts geprägt.
Verglichen mit dem eigentlichen China ist die Kolonie sehr jung. Wegen ihrer sehr kurzen Geschichte und des immer neuen Zustroms von Bewohnern der benachbarten Volksrepublik ist die Bindung der Bevölkerung zur Tradition trotz der technischen Modernität noch sehr stark. Besonders der Metakonfuzianismus, eine vereinfachte, vor allem auf dem Land verbreitete und praxisorientierte Form dieser Philosophie, spielt im Verhalten der Hong Kong-Chinesen eine große Rolle. Er ist die Ursache des starken Bedürfnisses nach Familienbindung, Hierarchie, Harmonie und Überschaubarkeit.
In der Praxis ergeben sich daraus einige charakteristische Eigenarten des Geschäftslebens und des Verhältnisses zum Staat. Die meisten Betriebe sind durch Verwandschaftsbeziehungen organisiert und relativ klein. Das Bestreben nach Harmonie führt zu einem fairen Konkurenzverhältniss, hat aber auch durch den verbreiteten Konformismus eine hemmende Wirkung auf technische Innovationen. Dieses Problem der mangelnden Fähigkeit zur eigenständigen Entwicklung hat seine Ursprünge auch in der Eigentümlichkeit der chinesischen Schulen. Im Konfuzianismus hat Lernen einen hohen Stellenwert, da es eine der wenigen gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten in diesem hierarchisch geprägten System darstellt. Dieser Umstand hat sich zunächst positiv auf die Wirtschaftsentwicklung Hong Kongs ausgewirkt. Durchschnittlich gibt ein Haushalt 15-20% seines Einkommens für Schulbildung aus. Die gute Ausbildung seiner Bewohner ist für die Kolonie ein wichtiger Standortsvorteil. Weil sich das Lernen in den Schulen jedoch weitgehend auf ein Auswendiglernen beschränkt, kommt es auf dem Bildungsgebiet zur Stagnation.
Religion und die Herkunft vieler Familie als Flüchtlinge wirkten sich ebenfalls auf die Wirtschaft aus. Kostspielige Ahnenverehrung zwang die Bewohner Hong Kongs regelrecht zum Anhäufen von Vermögen. Das Sicherheitsbedürfnis der Neuankömmlinge führte zu einer Sparsamkeit, durch die viel Kapital zur Investition bereit steht.
Am bemerkenswertesten ist allerdings das weiterleben der bäuerlichen Denkweise in diesem urbanisierten Land. Sie ist durch ein Autarkiebestreben, Loyalität und gegenseitige Verpflichtung innerhalb des Clans und einer starken Abgrenzung nach außen gekennzeichnet. Die einzelnen Sippen haben ein distanziertes Verhältnis zum Staat und versuchen stets, ihre belange selbständig zu Regeln. In der Zeit der großen Flüchtlingswellen gab es zahlreiche Selbsthilfeorganisationen. Die bekannten asiatischen Triaden sind aus solchen Gesellschaften hervorgegangen. Der größte Teil des "Wohlfahrtsprogrammes" wird privat finanziert. Hierbei beteiligen sich auch führende Geschäftsmänner, da gesellschaftliches Prestige in dieser Kultur nicht über Besitz sondern über Bildung und Großzügigkeit gesteigert wird.
Die ausgedehnte Selbstorganisation der Hong Kong-Chinesen harmonierte sehr gut mit dem Regierungsstil der Briten, die sich aus den wirtschaftlichen Belangen weitestgehend heraushalten. Aus diesem Grund wird in Hong Kong wie in Großbritannien nicht der Staat für die eigene finanzielle Situation in Verantwortung gebracht. Wirtschaftliche Krisenzeiten führen deshalb nicht zu politischer Polarisierung. Dieser Umstand und das bereits erwähnte Sicherheitsdenken führten zu Stabilität. Nicht zuletzt darum hatte die Kulturrevolution im Nachbarland geringe Auswirkungen in Hong Kong.
Mit zunehmendem Wohlstand und Verstädterung folgte eine Änderung der Denkweise. Japanischen Frauen, deren Rückzug aus dem Arbeitsleben mit etwa 25 Jahren als selbstverständlich gilt, ist in Hong Kong eine lebenslange Beschäftigung möglich. Dies ist eine Folge der Modernisierung in einer ländlich und patriarchalisch orientierten Gesellschaft. Die meisten Folgen sind jedoch negativ.
Urbanisierung hatte die Auflösung der alten Clanstrukturen zur Folge. Da die Selbsthilfe nun meistens nicht mehr funktioniert, ist der Staat zu ausgaben im Sozialbereich und zu Eingriffen in die Wirtschaft gezwungen. Ein ebenso ernstes Problem hat sich paradoxerweise mit dem steigenden Wohlstand ergeben. Triaden waren ursprünglich Geheimgesellschaften zur Beseitigung der Fremdherrschaft der Quing-Dynastie und später Teil der Selbsthilfeorganisationen. Nach dem Sturz des Kaisers und der mit Hong Kongs Aufschwung an Bedeutung verlierenden gegenseitigen Sippenhilfe suchten sie sich eine neue Aufgabe und fanden sie in der Kriminalität. Der große Einfluß dieser heutigen Mafia-Organisation macht sich in der Heroinabhängigkeit von geschätzten 2-3% der männlichen Bevölkerung Hong Kongs bemerkbar.
Das Abnehmen des Sicherheitsbedürfnisses nach der wirtschaftlichen Etablierung der ehemaligen Flüchtlinge brachte der Kolonie Vor- und Nachteile. Die jetzt enorm hohe Risikofreudigkeit führte einerseits zu zahlreichen Konkursen, brachte dem Staat aber pro Saison bis zu 7.000.000.000 US$ Wetteinnahmen auf der Rennbahn. Auf diese Weise steht der Regierung so viel Geld zur Verfügung, daß die Wirtschaft nicht durch hohe Steuern belastet werden braucht.
2.4. Verhandlungen Thatcher - Deng Xiao Ping
![]() 2.4.1.
Machtverhältnisse zum Zeitpunkt der Verhandlungen
2.4.1.
Machtverhältnisse zum Zeitpunkt der Verhandlungen
Die ersten Verhandlungen über die Zeit nach dem Ablauf des
"Pachtvertrages" fanden im September 1982 statt.
Ursprünglich plante die britische Regierung, die laut Vertrag
für ewig von China abgetretenen Teile der Kolonie,
Hong Kong Island und Kowloon, unter ihrer Herrschaft zu
behalten. Zwar würde damit nur ein Zehntel des Territoriums bei
der Krone verbleiben und die Kolonie die wichtigste Grundlage
ihrer Existenz verlieren, aber Großbritannien hätte so
zumindest kurzfristig ein Einwandererproblem gelöst. Von den
Bewohnern Hong Kongs wurden nämlich 3,1 Millionen in der
Kolonie geboren und hätten somit das Recht gehabt, ins
"Mutterland" auszuwandern. Durch den Erhalt wenigstens
eines Teils der Kolonie hoffte man, einige der
Hong Kong-Chinesen zum bleiben zu bewegen. Die VR China
beansprucht jedoch alle Teile "Xiangangs" für sich, da
sie die Ungleichen Verträge nicht mehr anerkennt. Zwar hatte die
Regierung in Beijing die Verträge nach den Opiumkriegen schon
immer für Unrecht erklärt, aber aus wirtschaftlichen
Überlegungen bis dahin noch keine Konsequenzen daraus gezogen.
Bis zur Gründung der Wirtschaftssonderzonen wurde die Kolonie
als Tor zur Außenwelt benötigt. Da Hong Kongs
Monopolstellung in den 80er Jahren nicht mehr existent war und es
für die Volksrepublik militärisch ein leichtes gewesen wäre,
die wenigen Kolonialtruppen zu besiegen, stimmte Großbritannien
schließlich unter vorgeblicher Freiwilligkeit der Übergabe
seiner Besitzung zu, um so wenigstens das Gesicht zu wahren.
Daß nun alles vom Wohlwollen der chinesischen Regierung abhing, ist in Hong Kongs neuem Basic Law ersichtlich. Sämtliche Gesetze der zukünftigen Sonderverwaltungszone müssen von Beijing vor ihrem Inkrafttreten bestätigt werden.
![]() 2.4.2. Inhalte der
Vereinbarungen
2.4.2. Inhalte der
Vereinbarungen
Im Dezember 1984 folgte schließlich die "Gemeinsame
Erklärung", über die Details des Zukunftskonzeptes für
Hong Kong. Im Widerspruch zu ihrem Namen wurde sie im
wesentlichen von China diktiert. Unter dem Schlagwort von
"ein Land - zwei Systeme" soll in Hong Kong
einiges beim alten bleiben. Ironischerweise ahmen hier die
sozialistischen Chinesen die Kolonialpolitik der Briten nach. Sie
bringen nur die Bereiche unter ihre Kontrolle, die direkt mit
ihrer Herrschaft verbunden sind. Der übrige, vor allem
kulturelle Teil des Lebens bleibt unverändert.
Weiterhin soll in Hong Kong die Freiheit der Rede, der Presse, der Vereinigung, der Religion, der Bildung und des Verkehrs gewährt werden. Der Freihafen und sogar der Hong Kong-Dollar sollen erhalten bleiben. Als teilautonomes Gebiet bleiben Verträge wie die Mitgliedschaft im IOC, die ausschließlich Kultur betreffen, , bestehen.
Politisch soll begrenzt Autonomie gewährt werden. So wird die Sonderverwaltungszone ein eigenes Parlament, eine Gerichtsbarkeit und eigene Gesetzgebung erhalten. Die regionale Regierung wird sich aus Hong Kong - Chinesen zusammensetzen. Die Unabhängigkeit wird dadurch eingeschränkt, daß der Regierungschef von der Zentralregierung eingesetzt wird und alle Gesetze von ihr bestätigt werden müssen. Verteidigung und Außenpolitik gehen ebenfalls in ihre Verantwortung über.
![]() 2.5. Staatsaufbau
(Stand September 1991)
2.5. Staatsaufbau
(Stand September 1991)
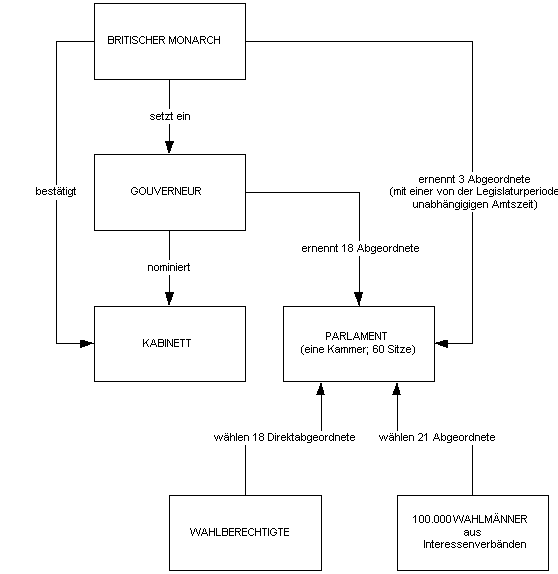
Anders als im "Mutterland" Großbritannien selbst hat der Monarch in der Kronkolonie mehr als nur repräsentative Funktionen. Der gesamte Aufbau des Staatssystems ist sehr autoritär und sah bis zu den Reformen der letzten Jahre keinerlei Partizipation der Bevölkerung vor. Er ist auf die kolonialen Interessen der Briten ausgerichtet und schränkt die Freiheit seiner Bürger zugunsten wirtschaftlicher Standortsvorteile ein. Die starke Stellung des Gouverneurs, der nur seinem Monarchen verantwortlich ist und die Richter der Kolonie ernennt, führte zur Unabhängigkeit seiner Politik von lokalen Interessengruppen und zu Stabilität.
Der Prozeß der beginnenden Demokratisierung Hong Kongs ist erst nach der "Joint Declaration" von 1984, in der die endgültige Aufgabe der Kolonie beschlossen wurde, eingeleitet worden. Die Bevölkerung hat auch nach der Einführung einer begrenzten Wahlmöglichkeit nur geringen Einfluß auf ihre Regierung Aus diesem Grund liegt die Vermutung nahe, daß der freiheitlichere Staatsaufbau Hong Kongs vor allem dem besseren Image der abziehenden Briten dienen soll. Ein Indiz hierfür ist, daß der weitere Ausbau der "Demokratie" mit der Erhöhung der Sitze der durch die Bevölkerung gewählten Abgeordneten auf 50 erst für 1995 geplant war. Zwei Jahre vor dem völligen Verlust der Kolonie kann eine größere Beteiligung der Untertanen an der Staatsmacht den Interessen Großbritanniens sicherlich keinen großen Schaden mehr zufügen. Wie wenig die Bevölkerung vom veränderten Regierungssystem erwartet, ist in der Wahlbeteiligung von 20% bei den letzten Parlamentswahlen deutlich geworden.
Diese Seite wurde von Markus Beier erstellt. Sie wurde das letzte Mal am 17.07.1999 aktualisiert.